Aktuelles
Der Tod als Routine?
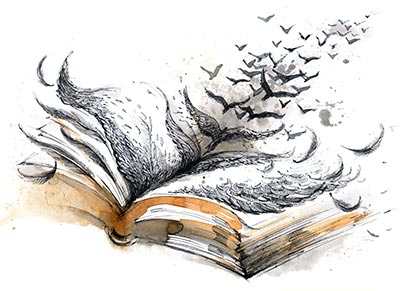
An jedem Tag ist es ein Kommen und Gehen.
Babys erblicken das Licht der Welt - für die Eltern bedeutet es das größte Glück.
Sterbende treten über die Schwelle – für die Hinterbliebenen bedeutet es, zu trauern.
Geburt und Tod sind Realitäten unseres Lebens.
Durchschnittlich sterben in Deutschland jeden Tag 2.600 Menschen. Diese Zahl macht deutlich, wie normal und alltäglich der Tod ist. Jedoch hat die Mehrzahl der Bevölkerung keine Berührungspunkte damit. Wenn überhaupt, dann nur durch die Traueranzeigen in der Zeitung. Doch wie ist es, wenn ein Beruf ausgeübt wird, bei dem der Tod an der Tagesordnung steht? Wie sieht es aus in der Gefühlswelt eines Bestatters – wird der Tod irgendwann zur Routine?
Funktionieren, wenn die Welt Kopf steht. Unterstützen, zuhören, Lösungen finden. Gemeinsam mit den Hinterbliebenen den einen letzten Weg finden. Den Abschied besprechen, vorbereiten und organisieren. Für die Trauernden da sein und ihnen zeigen, dass sie damit nicht allein sind. Denn es betrifft jeden von uns. Das tröstet. Bestatter wissen das.
Die Routine entsteht tatsächlich. Denn der Kontakt mit trauernden Menschen findet beinahe täglich statt. Doch genau dafür braucht der Bestatter sein wichtigstes Handwerkszeug: Einfühlungsvermögen.
Es geht um den Umgang mit sehr privaten, familiären und emotionalen Momenten. Und es geht darum, etwas Besonderes zu erschaffen. Denn jeder Mensch und jede Biografie sind anders. Die Gestaltung eines passenden und sehr persönlichen Abschieds für Verstorbene, die geliebt wurden und nun fehlen – das ist alles andere als Routine.
(Foto: AdobeStock #63336841 von okalinichenko)
Die Sache mit dem Glück … ist das Glückssache?

„Er hatte ein erfülltes und glückliches Leben.“ Das sagt man am Lebensende über einen Verstorbenen bestenfalls. Und das ist es doch, was wir uns alle wünschen: Wir wollen glücklich sein.
Wobei nach dem Grad des Glückes gefragt gerade ältere Menschen betonen, dass sie in erster Linie zufrieden sind. Wie hängt das zusammen – das Glück und die Zufriedenheit? Zufrieden klingt zunächst nach einer mittleren Schulnote, also nicht richtig gut, nicht richtig schlecht. Es klingt nach Mittelmaß, vielleicht sogar nach Resignation.
Doch bei Betrachtung der Wortherkunft erkennt man: Im Wort Zufriedenheit steckt der Frieden. Das fällt vielleicht nicht jedem sofort auf. „In Frieden“ zu sein ist ein Zustand, der von innen heraus kommt.
Der Schlüssel zum Glück steckt von innen.
Wer in sich hineinhorcht, kann für seinen eigenen Frieden und für Wohlbefinden sorgen. „Wie fühle ich mich?“ Das ist eine wichtige Frage an sich selbst. Denn hinter unseren Gefühlen stecken die Bedürfnisse. Das Gefühl von Angst beispielsweise weist auf das Bedürfnis nach Sicherheit hin. Indem wir unsere eigenen Bedürfnisse erkennen, können wir im nächsten Schritt versuchen, sie zu erfüllen.
Und schon sind wir auf dem richtigen Weg zu einem erfüllten und glücklichen Leben.
Wenn jeder es als ureigene Aufgabe betrachtet, diesen Schlüssel für sich selbst zu finden, dann ist für alle gesorgt. Noch dazu funktioniert es so viel besser als andersherum. Denn wenn wir erwarten, dass andere uns glücklich machen, dann warten wir vielleicht vergeblich.
(Foto: AdobeStock #195248334 von heliopix )
Same same but different

Die Macht und die Gewohnheit
Kann es sein, dass in den vergangenen Wochen, insbesondere seit der Maskenpflicht, viele Menschen doch wieder in ihre alten Gewohnheiten verfallen? Das Gedrängel im Supermarkt und in anderen Geschäften, in Bus und Bahn sowie auf öffentlichen Plätzen findet zunehmend wieder statt. „Ich zuerst“ – eine Philosophie oder besser gesagt ein Laster, das für eine kurze Zeit aus unserem Alltag verbannt wurde, scheint wieder allgegenwärtig. Menschen wähnen sich in Sicherheit, weil sie eine Maske tragen. Warum also jetzt noch Abstand halten?
Mal abgesehen davon, dass ein Ende der Pandemie eher nicht in Sicht ist und im kommenden Herbst und Winter wieder Grippeviren unterwegs sein werden, ist es doch generell eine Frage des Respekts, Abstand zu halten, rücksichtsvoll miteinander umzugehen und vielleicht auch einmal die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Ob am Obststand oder im öffentlichen Verkehr. Drängeln ist scheinbar wieder in. Zu bestimmten Zeiten schiebt sich hastig ein Pulk von Menschen in die Bahn, die es nicht abwarten können, schnell einen Sitzplatz zu ergattern. Dabei wird nicht darauf geachtet, ob vielleicht ältere oder körperlich beeinträchtigte Menschen schon ausgestiegen sind. Im Gegenteil: Wer zu lange für den Ausstieg braucht, wird mit genervten Blicken oder Augenrollen gestraft – ein leider wiederkehrendes Szenario, dass bereits vor Corona definitiv zum Alltag gehörte.
„Gemeinsam durch die schwere Zeit“ hieß es noch vor ein paar Wochen überall und sicherlich gibt es auch Menschen, die sich untereinander helfen, bedingungslos, rücksichts- und respektvoll. Auf der anderen Seite gibt es auch diejenigen, die die Not der Menschen knallhart ausgenutzt und einige Produkte des Alltags zu unverschämt überteuerten Preisen angeboten haben – gerade in der Zeit, als Masken und Hygieneartikel im Handel kurzfristige Mangelware waren.
Bleibt die Frage, ob Corona wirklich etwas Grundlegendes im Hinblick auf das egobasierte Verhalten mancher Menschen verändert hat. Vielleicht hier oder da schon, aber im Allgemeinen wohl eher nicht. Also diesbezüglich bleibt alles wie gehabt und ist dennoch ein bisschen anders.
Bild: #340967954 von akhenatonimages - stock.adobe.com
Was macht die Pandemie mit uns?

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sind extrem vielschichtig. Es gibt unterschiedliche Betrachtungsweisen und jeden Tag neue Nachrichten sowie Einschätzungen der Experten. Für jeden Einzelnen von uns kommt die ganz eigene, persönliche Situation hinzu, unter deren Einfluss wir auf die aktuellen Ereignisse blicken.
Dass in unserer auf wirtschaftlichen Gewinn ausgerichteten Gesellschaft nun Werte wie Gesundheit, Solidarität und der Schutz von alten oder vorerkrankten Menschen an oberster Stelle stehen, mag für manchen überraschend sein. So sehr man sich über diesen Sinneswandel freuen möchte, so unvermeidbar ist jedoch der Blick auf das System, das infolge eines länger anhaltenden Shutdowns nicht mehr funktionieren wird. Eine zu erwartende Rezession wird Arbeitslosigkeit, Unsicherheit, schlimmstenfalls auch Armut und Krankheit mit sich bringen. Nun gilt es abzuwägen, welches das geringere Übel ist.
Sich in diesem Zusammenhang über die Delfine im Hafen von Venedig zu freuen oder über die sinkenden Emissionswerte, erscheint fragwürdig und geradezu pietätlos. Ist es angesichts steigender Sterbefälle oder bedrohter Existenzen nun wirklich angebracht, sich gedanklich in eine himmelblaue, schadstofffreie Welt zu flüchten? Wer in dieser Krise nicht zuerst das Bedrohliche sähe, der nähme weder die Krise noch das Leben der Menschen ernst. Nähe durch Abstand – und was jetzt Hoffnung macht
Es erscheint paradox, aber trotz Kontaktverbot, Ausgangssperren und Sicherheitsabstand kommen sich die Menschen gerade jetzt einander näher. Das Gefühl innerer Verbundenheit ist groß, der Zusammenhalt in der Gesellschaft stark und die Solidarität ist gelebte Realität. Es zeigt sich, dass der Abstand, den wir alle halten müssen, lediglich eine physische Distanz ist. Miteinander reden, sich über Ängste und Sorgen austauschen, einander zuwinken, sich anlächeln – all das begegnet uns jeden Tag und ist Ausdruck wahrer Menschlichkeit. Die Pandemie zeigt uns auf eindrucksvolle Art und Weise, dass wir alle zur gleichen Spezies gehören. Wir alle – alle Menschen auf dieser Welt – sind verletzlich. Diese Erkenntnis sollte unseren Zusammenhalt stärken, auch über die Pandemie hinaus.
(Foto: AdobeStock #334466328 von Sergey)
Jetzt ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge.

So definiert die Bundeskanzlerin den Begriff Fürsorge, aus aktuellem Anlass.
Gibt man dieser Tage den Begriff Fürsorge in die Suchmaschinen ein, erscheint ganz oben auf der Liste die Rede an die Nation von Frau Merkel vom 18. März 2020, gefolgt von Wikipedia, welches folgende Definition anbietet:
„Fürsorge bezeichnet die freiwillig oder gesetzlich verpflichtend übernommene Sorge für andere Personen oder Personenvereinigungen.“
Vielleicht ist ja jetzt die Zeit gerade über solche Begriffe wie Fürsorge zu sinnieren und einmal zu benennen, wer sich ihrer inhaltlich annimmt. Trennt man den Begriff, erhält man „Für“ und „Sorge“. Der erste Wortteil also Verbunden mit einem Startpunkt und einem Ziel: ein oder mehrere Menschen für einen oder mehrere andere. Der zweite Wortteil, Sorge haben oder tragen, als vorrauschauende Verantwortung für ein mögliches Geschehen: z. B. eine Krankheit, eine menschliche oder wirtschaftliche Notsituation: ein oder mehrere Menschen für einen oder mehrere andere.
Der Beruf des Altenpflegers, des Sozialarbeiters, der Krankenschwester, des Arztes* und eben auch der des Bestatters haben sich genau dies zur Profession gemacht: Fürsorgen! Von Mensch zu Mensch.
Dafür heute einmal: Danke!
*und natürlich viele mehr
Bild: # 301894830 von - naturaleza stock.adobe.com
Wo und wie will man sterben?

Jeder vierte Deutsche würde am liebsten im Hospiz sterben.
Das ergibt die Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des Deutschen Hospiz- und Palliativerbandes (DHPV) 2017.
Hiernach ist die Zahl der Menschen, die zu Hause sterben möchten in den letzten Jahren auf 58% gestiegen. Die Zahl derjenigen, die in einem Hospiz die letzten Tage verbringen möchten auf 27%. Seit der hitzigen Bundestagsdebatte über organisierte Sterbehilfe und der beschlossenen Stärkung der Hospiz- und Palliativversorgung (bereits in 2016), ist der Umgang mit dem Thema Sterben in unserer Gesellschaft wesentlich offener und selbstbewusster geworden. Viele Menschen haben eine Vorstellung über das „Wie“ und „Wo“. Das brandaktuelle Urteil des BGH vom 25.02.2020 besagt, dass jeder Mensch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben hat. So darf die Frage nach dem „Wie“ bei unheilbar kranken Menschen wieder neu gestellt werden.
Das „Wo“: Hier klaffen Wunsch und Wirklichkeit nach wie vor weit auseinander. Gerade einmal 23% der Befragten, die angegeben haben zu Hause sterben zu wollen gelingt dies auch. 4% der Befragten haben angegeben im Krankenhaus sterben zu wollen; tatsächlich sind es 58% im Jahr 2017. Hospize, ambulante Hospizdienste und Palliativstationen könnten hier helfen – aber das Angebot reicht bei weitem nicht aus, der Bedarf ist zu groß.
Das „Wie“: Der Anteil derjenigen Bürger, die über eine Patientenverfügung verfügen, ist von 26 % in 2012 auf 43% in 2017 gestiegen. Tendenz steigend. Auch hier klaffen Wunsch und Wirklichkeit auseinander, ist in der Patientenverfügung nicht detailliert festgelegt, was genau z.B. lebensverlängernde Maßnahmen sind, so kann diese Verfügung laut einem Urteil des BGH wirkungslos sein. Im Urteil des BGH wurde nun klargestellt, dass einzelne medizinische Maßnahmen konkret benannt werden müssen.
Eine gute und intensive Beratung in Sachen „Wie“ und „Wo“ sind ratsam, denn das hat das Leben verdient.
Quelle: DHPV www.dhpv.de
Bundesjustizministerium: www.bmjv.de, Vorsorge und Patientenrecht
Bild: #246269779 von Thomas Reimer - stock.adobe.com
Reiseführer für Verstorbene

Der Dalai Lama erklärt in einem Interview: „Das Leben ist wie ein Wechsel. Wenn Ihre Kleider alt geworden sind, schmeißen Sie sie weg und nehmen neue, schöne Kleider. So ähnlich ist es mit dem alten Körper, der nicht mehr richtig funktioniert. Man wechselt hinüber zu einem neuen Körper. Einem Körper mit mehr Energie und Frische.“
Im tibetischen Buddhismus geht man davon aus, dass der Geist nach dem Tod weiterexistiert. Er erfährt lediglich eine Wandlung und wird in einem anderen Körper wiedergeboren. „Bardo“ wird der Zeitraum zwischen dem Moment des Todes und der Wiedergeburt genannt. In dieser Zeit geht das Bewusstsein auf eine Reise. Um diese Reise sicher zu geleiten, wird der Verstorbene aufgebahrt und ihm wird mehrere Tage lang aus dem „Bardo Thödol“, dem tibetischen Totenbuch, vorgelesen.
„Fürchte Dich nicht vor dem Licht, sondern lasse Dich voller Vertrauen und Hingabe darauf ein.“
Das tibetische Totenbuch kann wie ein Reiseführer für Verstorbene verstanden werden. Die Texte werden dem Gelehrten Padmasambhava zugeschrieben, der im 8. Jahrhundert n. Chr. den Buddhismus in Tibet etabliert haben soll. Dem Verstorbenen werden konkrete Anweisungen gegeben, wie er sich zu verhalten hat. So kann er ohne Angst und voller Zuversicht in die nächsten Ebenen weiterreisen.
Buddhisten glauben daran, dass es im Tod einen Augenblick der Klarheit gibt, eine Begegnung mit uns selbst. Diesen Moment zu erkennen, ist von großer Bedeutung. So kann es bestenfalls zur Erleuchtung kommen, zumindest aber können günstige Bedingungen für die nächste Existenz geschaffen werden. Denn bestimmte Prägungen und psychische Grundmuster werden gespeichert und bei der Verbindung mit einem neuen Körper wieder aktiviert.
Der Dalai Lama betont, dass es wichtig ist, den Tod nicht zu verdrängen, sondern sich mit ihm auseinanderzusetzen: „Die Realität des Todes ist in allen buddhistischen Gesellschaften Ansporn zu tugendhaftem Handeln. Über den Tod zu kontemplieren, gilt als etwas, das von Furcht befreit.“
(Foto: AdobeStock #250476548 von Dmytro Titov)
„Friedhof 2030“

Eine Initiative des Kuratoriums Deutsche Bestattungskultur und des Bundesverbandes Deutscher Bestatter e.V.
Ihre Meinung ist gefragt: Die Initiative Friedhof 2030 beschäftigt sich mit der kulturellen Entwicklung des Trauerortes „Friedhof“. Die Erhaltung kultureller Werte, der Schutz historischer Bestände und die sich ändernden Bedürfnisse der Gesellschaft heute stehen im Mittelpunkt.
Die Initiatoren von Friedhof 2030 fordern von Friedhofsverwaltungen, Städten und Kommunen und auch Kirchen ein wesentlich kreativeres und engagierteres Vorgehen als in der Vergangenheit. Ein „Weiter so“ wird das schon viel diskutierte Sterben der Friedhöfe nicht aufhalten können.
Aber diesmal ist auch die Meinung der Bürger gefragt, denn die Hinterbliebenen und Nutzer von Friedhöfen gestalten sie wesentlich mit: die deutsche Bestattungskultur. Auf der Website von Friedhof 2030 wird Ihre Meinung explizit erfragt. Und es gibt sehr viele Informationen über kreative Ideen, Friedhöfe am Puls der Zeit zu gestalten.
Praxisbeispiele, Vorträge und auch eine Initiative, die deutsche Friedhofskultur in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufzunehmen, finden sich auf der Website.
Obwohl die Bestattungskultur und die Gestaltung der Friedhöfe gerade bei uns in Deutschland vielfältig sind und es besondere regionale Ausprägungen zwischen Nord und Süd und Ost und West gibt, wird es dennoch Zeit, die Zukunft zu planen.
Damit Friedhöfe nicht aussterben und die Geschichten der Menschen und der Gemeinden mit ins Grab nehmen.
Ein Blick auf die Website der Initiative Friedhof 2030 lohnt sich!
www.friedhof2030.de
Bild:#16401086 von Glenda Powers - stock.adobe.com
Erfahrung – die große Unbekannte

„Meiner Erfahrung nach …“ So beginnen manchmal ältere Menschen, wenn sie aus ihrem Leben erzählen. Seien es die eigenen Eltern, Großeltern oder Bekannte – in jedem Falle lohnt sich nun gutes Zuhören. Denn von den Älteren kann man so einiges lernen. Mit ihrer Lebenserfahrung können sie den Jüngeren wertvolle Hinweise und Denkanstöße geben.
Junge Leute wissen mit dem Wort „Erfahrung“ oftmals noch gar nichts anzufangen. Was soll das denn sein? Hört sich irgendwie an wie „Schnee von gestern“. Die Erfahrung bleibt genau so lange die große Unbekannte, wie es im eigenen Leben noch wenig davon gibt.
Die Lebenserfahrung ist per definitionem die Summe aller Erlebnisse und der daraus gezogenen Erkenntnisse. In humanistischen Denkweisen betrachtet man das Leben als einen allmählichen inneren Wandlungsprozess. Durch das Sammeln von Erfahrungen entwickelt sich der Mensch von einem Zustand des Nichtwissens hin zu einem Zustand der Aufklärung und Weisheit.
Jedes Erlebnis kann dabei zu einer lehrreichen Lektion werden. Je nachdem, was wir auf unserem Lebensweg erfahren, gewinnen wir individuelle Erkenntnisse. So sind wir zu demjenigen geworden, der wir sind.
Wir kommen nicht umhin, unsere Erfahrungen selbst zu sammeln und das Leben tatsächlich „am eigenen Leib zu erfahren“. Dafür offen zu sein und sich nicht zu verschließen, ist wichtig für die eigene Entwicklung. Man kann sich schon denken, dass der Erfahrungsschatz zuhause auf dem Sofa mit einer Tüte Gummibärchen nicht gerade größer wird.
Deswegen ist es gut, sich selbst zu fordern und sich auch außergewöhnlichen Umständen auszusetzen. Etwas Neues auszuprobieren, was man noch nie zuvor gemacht hat, an einen noch unbekannten Ort zu reisen, intensiv mit allen Sinnen die Natur oder Musik wahrzunehmen, all das sind Erlebnisse, die in unseren Erfahrungsschatz übergehen.
Es ist ein Schatz, wertvoller als alles Vermögen oder Besitztümer, die wir ansammeln könnten. Denn wer auf die Jahre seines wirklich gelebten Lebens zurückblicken kann, der kann jederzeit auf einen inneren Reichtum zurückgreifen, der Stärke und Mut verleiht.
Bild: # 229251806 von vladk213 - stock.adobe.com




